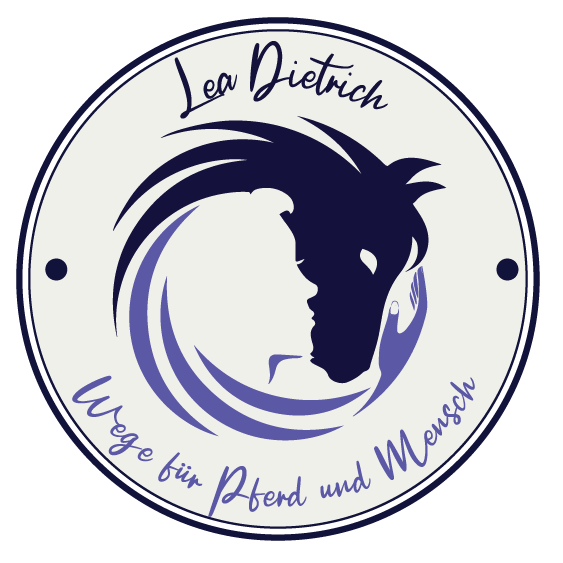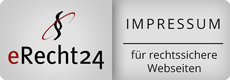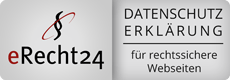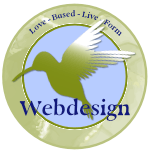TOP AKTUELL:
Spieglein an der Wand
Mein aktueller Artikel in der "Mein Pferd 02/2024". Ein Hallenspiegel hilft dem Reiter, sich und sein Pferd durch einen kurzen Blick selbst zu kontrollieren ...
LESEPROBE:
Ein Hallenspiegel hilft dem Reiter, sich und sein Pferd
durch einen kurzen Blick selbst zu kontrollieren. So können Fehler im Training
schnell erkannt und korrigiert werden – vorausgesetzt, das Gefühl bleibt dabei
nicht auf der Strecke. Was dem Menschen nützt, irritiert hingegen viele Pferde,
denn sie nehmen den Spiegel völlig anders wahr als wir ....
WIR SCHAFFEN DAS!
Mein aktueller Artikel in der "Mein Pferd 11/2023". Diesmal geht es um schreckhaftes Verhalten beim Pferd.
LESEPROBE:
Dann gibt es einen Grund dafür. Wichtig ist, frühe Anzeichen von Anspannung zu erkennen und schnell zu handeln. Dann können Pferd und Reiter eine
kritische Situation gemeinsam meistern
Ein lauter Traktor, ein bunter Regenschirm, ein bellender Hund, eine wehende Plane – es gibt unzählige Reize, denen Pferde in der Menschenwelt ausgesetzt sind. Vor allem plötzlich auftretende, unbekannte Gegenstände, Geräusche oder schnelle Bewegungen sind für sie schwer einzuschätzen und verunsichern sie häufig. Sie lösen Besorgnis über den eigenen Zustand aus. Die Folge? Die Vierbeiner sind in Alarmbereitschaft. Sie fokussieren sich nur noch auf den Reiz, um ihre Gesundheit und ihr Leben bestmöglich zu schützen. Dieses Verhalten resultiert aus einem Instinkt, der so tief in ihnen verankert ist, dass der Mensch ihn weder wegzüchten noch komplett abtrainieren kann. „Pferde sind Flucht- und Beutetiere. Deshalb liegt ein prinzipiell schreckhaftes Verhalten evolutionsbedingt in ihrer Natur. Die Tiere mussten in freier Wildbahn ...
Mein Neuer Betrieb
Seit Januar 24 habe ich jetzt meinen eigenen Beritt- und Einstellerbetrieb. In diesem Podcast spreche mit Carina W. und Lea. S auf Spotify - #PsychoLoHü - über meinen neuen Betrieb.
LESEPROBE:
- Wenn Du mehr über mich erfahren möchtest?
- Wenn Du wissen möchtest was meine Liebe zu Pferden entfacht hat?
- Wenn Du wissen möchtest welche Ängste ich mit in diese neue Aufgabe genommen haben?
- Wenn Du wissen möchtest wie ich mir die Zukunft auf meiner Anlage vorstelle?
- Wenn Du ganz einfach ein Stück auf meinem Weg begleiten möchtest?
Dann höre Dir diesen Podcast an!
Herzlich Willkommen auf meinem Beritt- und Einstellerbetrieb
Mein Name ist Lea Dietrich (Pferdeverhaltenstrainerin IVK)
Mein Ziel sind harmonische und vor allem stressfreie Beziehungen zwischen Pferd und Mensch.
Auf meiner Anlage mit Offenstall Haltung, Reithalle, Roundpen und vielen Extras liegen meine Schwerpunkte auf dem Beritt von Jungpferden und einem angenehmen Einstellerbetrieb.
Unabhängig von Deiner Reitweise unterstütze ich Dich & Dein Pferd gerne auf Eurem gemeinsamen Weg!
Die Anlage in Bildern:

IVK mit Offenstall und Roundpan

So schön ist es bei uns

Reithalle von der Wiese aus

Offenstall mit Blick auf Reithalle

Herde auf der Wiese

Offenstall in Abendstimmung

"Feel free" im Offenstall

Zusatzboxen

Sattelkammer

Seminarraum

Aktuelle Kurse & Termine
Hier finden wir gemeinsam "Wege für Pferd und Mensch".
Willkommen zu meinem Kursangebot!
Ich biete verschiedene Kurse an die darauf ausgerichtet sind, auf die Bedürfnisse meiner Kunden einzugehen und individuelle Lösungen anzubieten.
Egal, ob du mit einem schwierigen Pferd zu kämpfen hast oder einfach deine Fähigkeiten im Umgang mit deinem Pferd verbessern möchtest, ich stehe dir zur Seite und helfe dir, Probleme mit deinem Pferd zu lösen und eine bessere Beziehung zu ihm aufzubauen.
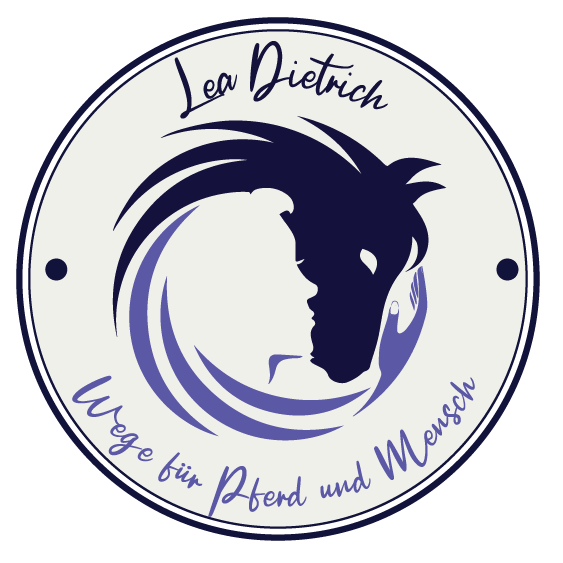
stattgefundene Veranstaltungen:
Im Individualkurs kann jeder Teilnehmer an dem Thema arbeiten, welches ihm gerade wichtig ist und wird da abgeholt, wo er gerade steht.
Mögliche Themen sind z.B. Bodenarbeit, Reiten, Jungpferdearbeit, Doppellonge, Kappzaumarbeit
Anstehende Veranstaltungen:
Im Individualkurs kann jeder Teilnehmer an dem Thema arbeiten, welches ihm gerade wichtig ist und wird da abgeholt, wo er gerade steht.
Mögliche Themen sind z.B. Bodenarbeit, Reiten, Jungpferdearbeit, Doppellonge, Kappzaumarbeit
Im Individualkurs kann jeder Teilnehmer an dem Thema arbeiten, welches ihm gerade wichtig ist und wird da abgeholt, wo er gerade steht.
Mögliche Themen sind z.B. Bodenarbeit, Reiten, Jungpferdearbeit, Doppellonge, Kappzaumarbeit
Im Individualkurs kann jeder Teilnehmer an dem Thema arbeiten, welches ihm gerade wichtig ist und wird da abgeholt, wo er gerade steht.
Mögliche Themen sind z.B. Bodenarbeit, Reiten, Jungpferdearbeit, Doppellonge, Kappzaumarbeit
Mein Partner für die Pferdegesundheit:
Osteopathie & Physiotherapie für Pferd und Hund

Mein Partner für das Training:
Institut für Verhalten und Kommunikation
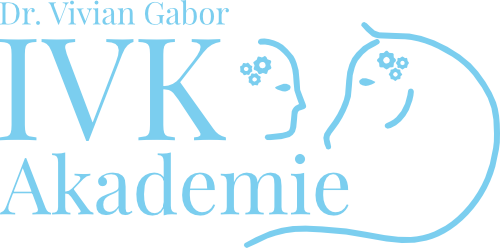
Wenn Du einen Kurs auf Deiner Anlage organisieren möchtest, nehme gerne Kontakt mit mir auf und wir schauen gemeinsam, in welchem Rahmen dieser stattfinden kann.
Trainiert wird in 2 Einheiten pro Tag je 30 Minuten als Tages- oder Wochenendkurs.
Die Kurszeiten können individuell angepasst werden, je nach Teilnehmerzahl. Maximal 6 Teilnehmer.

Pferde-Ausbildung & Beritt
- Anreiten und Fördern von Jungpferden
- Korrektur bei Problemen vom Boden/Sattel aus
- Training von Pferd und Mensch in der Bodenarbeit oder beim Reiten
- Einführung in die Arbeit an der Doppellonge
Unterbringung / Versorgung
Die Box wird jeden Tag gemistet und Heu steht immer zur Verfügung. Bei Bedarf ist auch das Füttern von Kraftfutter möglich.
Im Winter kommt dein Pferd stundenweise raus auf ein größeres Paddock und im Sommer auf einen eigenen Weideabschnitt.
Die Vorstellung beim Tierarzt, Osteopath oder Hufschmied kann nach Absprache von mir organisiert und übernommen werden.
Reitweisenübergreifend
Ich erarbeite die Grundlagen für das Pferd, um die reiterlichen Hilfen zu verstehen und dem Reiter zu vertrauen.
Vom Boden in den Sattel
Ich beginne das Training immer vom Boden aus und übertrage das Erlernte anschließend auf die Arbeit unter dem Sattel. So bekommt Dein Pferd eine gute Grundlage vom Boden & vom Sattel aus!
Individuelle Betreuung
Training und Versorgung werden auf das Pferd angepasst. Das Trainingstempo bestimmt immer das Pferd!
Dich mit eingebunden
Du kannst jederzeit beim Training dabei sein, wirst während des Beritts in das Training integriert und bekommst Unterricht mit deinem Pferd!
Kosten für Pferdeausbildung & Beritt
FAQ's zur Pferdeausbildung und Beritt
Meistens 2 Monate.
Ich bespreche mit dem Besitzer vorher genau über das Pferd und den aktuellen Trainingszustand und natürlich was das Ziel des Beritts ist. Dann kann ich aus meiner Erfahrung heraus eine ungefähre Abschätzung abgeben.
Ja! Der Besitzer darf sein Pferd immer besuchen außerhalb des Trainings und sooft wie möglich beim Training dabei sein. Hier sprechen wir uns bzgl. der Zeiten individuell ab. Außerdem bekommt der Besitzer Unterricht mit seinem Pferd bzw. wird in das Training eingearbeitet, um nach dem Beritt an das Training anknüpfen zu können.
Das Pferd muss gegen Influenza & Tetanus geimpft sein. Weitere Voraussetzungen gibt es generell nicht.
Über WhatsApp oder Telefon informiere ich den Besitzer mindestens 2-3 Mal die Woche über das Training und das Pferd.
Kommen Fragen oder Anliegen auf, bin ich jeden Tag erreichbar oder melde mich am selben Tag noch zurück.
Lea Dietrich

Im Institut für Verhalten & Kommunikation (IVK) arbeite ich mit Dr. Vivian Gabor in den Bereichen Pferdeausbildung und Stallmanagement zusammen.
Da ich sehr bestrebt darin bin, mich weiter zu bilden, und von anderen Trainern und Pferden zu lernen, war ich im Jahr 2018 auf der Hacienda Buena Suerte in Andalusien. Hier bekam ich Unterricht von dem Dressurtrainer David Guerrero Garcia.
Seit 2020 begleitet mich mein PRE Wallach “Fiscal“ auf meinem Weg.
,,Pferde sind von Natur aus skeptisch, klaustrophobisch und panisch veranlagt. Es liegt an uns, ihnen zu helfen, in unserer Welt zurecht zu kommen.''
Was zwei meiner Kunden sagen:

"
Lea Dietrich- Wege für Mensch und Pferd - Ein Beritt bei dem von A-Z alles stimmt. :) Lea macht einen super Job, ist immer pro Pferd, fair im Umgang und lässt den Pferden die Zeit, die sie brauchen. Sie sieht vor allem die Stärken und hilft die Schwächen zu verbessern. Der ruhige Umgang und das gute Gespür und Timing macht die Arbeit für die jungen Pferde wirklich angenehm und sie haben eine sehr vetraute Bindung zu Lea. Zudem wird sich wirklich um alles gekümmert und auch die Pferde werden bestens gepflegt und versorgt. Auch bei einem anstehenden Verkauf, steht Lea einem mit Rat und Tat zur Seite.
Wir haben uns mit unserer jungen Stute bestens aufgehoben gefühlt und würden Lea jederzeit wieder ein junges Pferd zur Ausbildung anvertrauen.
Liebe Lea, ganz lieben Dank für die tolle Zusammenarbeit und deine fantastische Arbeit bei unserer kleinen Emmi . ♡
Anja Engel - Kundin

“
Lea kann man nur absolut empfehlen!
Auch wenn das heute kein Standard mehr ist,
nimmt sie sich ausreichend Zeit für Pferd und Besitzer, ist offen für Vorschläge und Ideen und setzt vor allem auch auf eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit d. Menschen und dem ihr anvertrauten Tier.
Es werden keine Entscheidungen einfach ohne Rücksprache übers Knie gebrochen, kein "Hauptsache husch husch ein Ergebnis" und auch vor verhaltensoriginellen Vertretern schreckt sie nicht zurück.
Gearbeitet wird hier nicht pauschal nach Schema xy, sondern auch so, dass der Besitzer am Ende damit weiter arbeiten kann.
Auch bei der allgemeinen Betreuung gibt es nichts zu beanstanden. Pferde werden langsam aneinander gewöhnt, die Boxen sind groß+sauber und es wird auch auf eine angepasste Fütterung geachtet.
Kurz gesagt: Wer eine individuelle, pferdegerechte Lösung sucht, der ist hier genau richtig